In Auseinandersetzung mit neuen technischen Gegebenheiten der digital vermittelten Interaktion haben sich Theorien entwickelt, die soziale Interaktion von physischer Präsenz abkoppeln. Daniel Houben, der im Kontext der Etablierung digitaler Kommunikation von einer „Auflösung der Einheit von Körper, Raum, Zeit und Selbst“ spricht, leitet aus George Herbert Meads (1973) Idee der wechselseitigen Aufeinanderbezogenheit folgende Bedingungen für eine idealtypische Interaktionssituation ab: Teilnehmer*innen sollen: 1. simultan präsent sein; 2. sich gegenseitig wahrnehmen; 3. sich gegenseitig als Akteur*innen konstituieren; 4. zur Kommunikation bereit sein; 5. ein intersubjektives Zeichensystems haben; 6. die Sinneseindrücke verarbeiten können. Körperliche Ko-Präsenz ist hierfür nicht notwendig, stattdessen bedarf es nach Houben einer Aufeinanderbezogenheit, also einer Ko-Referenz.
So werden denn auch in der Theorieschule des „Presence Research“ virtuelle und physische face-to-face-Interaktionen als potentiell gleichwertig und lediglich heuristisch voneinander eindeutig unterscheidbar gesehen, unter anderem basierend auf dem Kriterium des subjektiven Empfindens der Präsenz Konstrukt, verknüpft mit Erfahrungen und Gefühlen in der mediatisierten Umgebung, d.h. des Eindrucks von Realismus und Immersion (Lombard/Ditton 1997: 7; Steuer 1992: 76; Ratanen 2003: 437; Kwan 2004: 30; Bakardjieva 2003; alle zit. n. Hahn/Stempfhuber 2015: 8-11). Präsenz kann somit auch als Zuschreibungseffekt beschrieben werden, als Konstruktion von „Realität“ einer Umgebung, wenn Annahmen über sie für wahr gehalten werden (Zhao 2003: 140f., zit. n. Hahn/Stempfhuber 2015: 12). Die Mediensoziolog:innen Cornelia Hahn und Martin Stempfhuber (2015: 16) verstehen daher Präsenz nicht als ontologischen Zustand, sondern als Prozess.
Wovon hängt es nun ab, in welchem Ausmaß digitale Kommunikation als Ersatz für physische face-to-face-Präsenz empfunden werden kann? Sowohl von den Medien als Dispositiven, die Bedingungen des Handelns vorgeben, als auch von den User:innen und ihren Aktionen, Wahrnehmungen, Gefühlen und Sinnkonstruktionen, die wiederum durch die physischen Bedingungen der Interaktion beeinflusst werden (Beck 2000: 11; Zhao 2003a: 446, zit n. Hahn/Stempfhuber 2015: 12). Dies ist abhängig von der Interaktivität – dem Ausmaß, in dem Inhalt und Form der Kommunikation beeinflusst werden können, der Visibilität, also den Möglichkeiten der Präsentation, der Geschwindigkeit, mit der Informationen ausgetauscht werden können und dem Ausmaß, in dem der mediatisierte Raum eine hohe Anreicherung durch Sinneseindrücke ermöglicht (Bregmann/Haythornthwaite 2003; Steuer 1992: 80, alle zit. n. Hahn/Stempfhuber 2015: 9, 12).
Und hier setzt die Kritik von Gabriela Jaskulla an der Online-Lehre an. Als problematisch wird von ihr das nicht nur das Fehlen, sondern auch, so vorhanden, die schlechtere Decodierbarkeit von für die Interaktion notwendigen Sinnesdaten wahrgenommen.
„Die digitale Lehre, zu der wir genötigt sind, geht zu Lasten der Subtilität. […] Die Chance, spontan zu reagieren, wenn man in reihenweise ratlose oder gar gleichgültige Gesichter sieht. Die Modulations-Möglichkeiten der Stimme – bei digitaler Übertragung oft grotesk verzerrt.“
Dagegen ist einzuwenden: die technischen Möglichkeiten sind doch inzwischen ein wenig besser, als diese Schilderung es vermuten lässt. Eine derart verzerrte Stimme ist mir in meiner Videokonferenzerfahrung noch nie begegnet.
Obgleich körperliche Kopräsenz im Hinblick auf Quantität und Qualität der verfügbaren sensorischen Informationen am umfänglichsten ist, ermöglichen die (visuellen und auditiven) Sinnesdaten in der synchronen Kommunikationssituation über Videokonferenzen ebenfalls eine Situationsdeutung. Natürlich fehlen ein paar Ebenen der Sinnesinformation, etwa in Hinblick auf den Körper als Zeichen vermittelndes Medium, wie etwa olfaktorische Reize (aber wer vermisst die?) und Körpersprache in ihrer Gänze – und somit zum Teil das, was, wie man mit dem Phänomenologen Hermann Schmitz (2007) sagen kann, leiblich an Atmosphäre spürbar ist.
Bei der Sichtbarkeit der Gegenüber muss selbstverständlich differenziert werden zwischen Veranstaltungen mit hoher Teilnehmer:innenzahl, und Seminaren mit wenigen Studierenden. Ohne technische Voraussetzungen und Bereitschaft zur Verwendung der Kamera gerät die Lehr-Lern-Situation zudem zum wenig interaktiven Monolog des:der Lehrenden vor der Schwärze des Bildschirms. In meinen bisherigen Seminaren schalteten immerhin gut die Hälfte bis 2/3 der Studierenden ihre Kameras ein. Die Zweiteilung in „sichtbare“ und „unsichtbare“ Studierende führt allerdings dazu, dass zur Sicherstellung die Partizipation der Letzteren der Chat immer im Blick behalten werden muss (mit ein wenig Hilfe seitens der Teilnehmer:innen klappt dies allerdings gut).
Bei den über die Kameras sichtbaren Personen ergibt sich jedoch sogar ein Vorteil gegenüber der Präsenzsituation im physischen Seminarraum: Alle haben einander gleichermaßen vor Augen – sie sitzen nicht füreinander teilweise verdeckt und unterschiedlich weit entfernt – und können so besser aufeinander reagieren, wodurch die empfundene Nähe und das wechselseitige Bezogensein also sogar größer sein können, entgegen der von manchen beklagten Distanz des ‚virtuellen Raums‘. Auch auf die Konzentration auf die Seminarinhalte kann es sich positiv auswirken, dass der gemeinsame ‚Seminarraum‘ nur noch aus dem Plattforminterface und den Gesichtern der Teilnehmenden besteht. Nebengespräche werden mühsamer und stören auch nicht mehr, da sie über die private Chatfunktion stattfinden. Da die Namen unter den Bildern sichtbar sind, können die Studierenden einander zudem schneller kennenlernen. Zwar ist dies nicht vergleichbar mit dem gemeinsamen Bier bei der Semesteranfangsparty, aber andererseits: seit Jahrzehnten vergemeinschaften sich Gamer:innen vorwiegend online, das gleiche gilt für Interessensgruppen in Foren und Social Media. Auch für die zerstreute Dozentin wird durch den repetitiven Lerneffekt, den die Nametags bieten, die Chance erhöht, spätestens bei der Korrektur der Hausarbeiten Name und Gesicht miteinander verbinden zu können.
Die Erfahrung der Kopräsenz kann natürlich gestört werden, neben Defiziten der Technik (Aussetzer der auditiven und visuellen Übertragung) durch plötzliche, unvermittelte Eindrücke, die sich nicht wiederholen und bei denen somit kein Habitualisierungseffekt eintreten kann. Etwa ein mitten in die Seminarsitzung hineinwummernder Stemmhammer (wir renovieren gerade), der bewirken kann, dass „der Raum, den du dir vorgestellt hattest, völlig weg“ ist, wie Martin Schweser (2000: 27) mit Bezug auf das Telefonieren schreibt. Immersion kann nur dann entstehen, wenn ein Teil der physischen Umgebung ausgeblendet werden kann: „Es ist die selektive Konstruktionsleistung der Nutzer, die zur Erzielung medialer „vividness“ notwendig ist.“ (ebd.). Ein liminaler Zustand zwischen Präsenz und Absenz kann sich hier einstellen. Auch hier erweist sich der digital divide unter anderem als care divide etwa in Form gleichzeitiger Kinderbetreuung; hinzu kommt, wie gesagt, der economic divide, der für Ungleichheiten bei der technischen Ausstattung sorgt.
Einen Blick auf die unterschiedlichen Aspekte der möglichen Habitualisierung und Beheimatung in digitalen Interaktionsumgebungen wird der letzte Teil dieses Blogbeitrags werfen.
Literatur
Bakardjieva, Maria (2003): Virtual togetherness: an everyday-life perspective. Media, culture & society 25, S. 291-313.
Bregman, Alvan/Haythornthwaite, Caroline (2003): Radicals of presentation: visibility, relation and co-presence in persistent conversation. New media & society 5 (1), S. 117-140.
Hahn, Cornelia/Stempfhuber, Martin (2015): Präsenzen 2.0. Zur Einführung in die soziologische Erforschung differenzierter Präsenz. In: Dies.: (Hg.): Präsenzen 2.0. Körperinszenierung in Medienkulturen. Wiesbaden: Springer, S. 7-22.
Kwan, Min Lee (2004): Presence, explicated. Communication Theory 14 (1), S. 27-50.
Mead, George Herbert (1973): Geist, Identität und Gesellschaft. Aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Ratanen, Terhi (2003): The new sense of place in 19th-century news. Media, culture &society 25, S. 435-449.
Schmitz, Herrmann (2007): Der Leib, der Raum und die Gefühle. Bielefeld, Locarno: Aisthesis Verlag.
Schweser, Martin J. (2000): Optionen – Wie sind wir verbunden? Ich nähe einen Knopf ans Hemd. In: Beck, Stefan (Hg.): Technogene Nähe. Ethnographische Studien zur Mediennutzung im Alltag. Münster: LIT.
Steuer, Jonathan (1992): Defining Virtual Reality: Dimensions for Determining Telepresence. In: Journal of Communication, vol. 42(4), S. 73-93.
Zhao, Shanyang (2003): “Being there” and the role of presence technology. In: Riva, G./ Davide, F./ Ijsselsteijn, W.A. (eds.): Being there: Concepts, effects and measurement of user presence in synthetic environments. Amsterdam: Ios Press, S. 137-146.
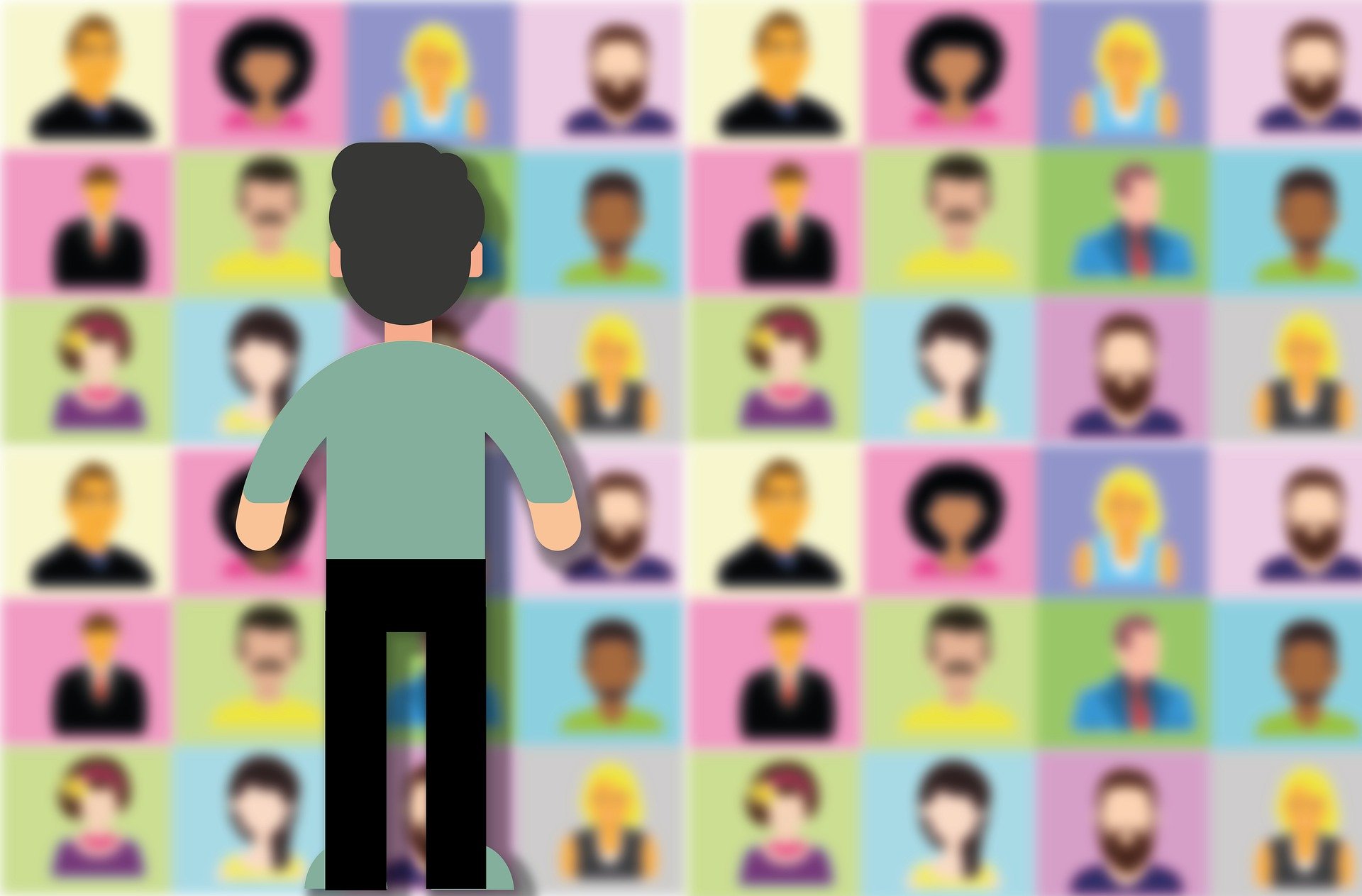
0 Kommentare